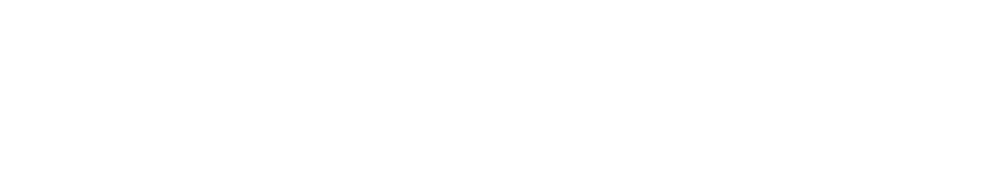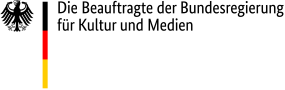#Kalenderblatt – Fritz Schmenkel: Deserteur und Überläufer im Zweiten Weltkrieg, verehrter Antifaschist in der DDR
19.02.21

Am 22. Februar 1944 wurde der ehemalige Wehrmachtsoldat Fritz Schmenkel in Minsk hingerichtet. Ein deutsches Militärgericht hatte ihn zum Tode verurteilt, nachdem er zu den sowjetischen Partisanen übergelaufen und von den Deutschen wieder gefasst worden war. Vielen in der DDR war später sein Name bekannt, denn er wurde als ein Held des Antifaschismus gefeiert. In Torgau wurde die Erinnerung an ihn besonders gepflegt, denn hier soll er als Soldat eine Strafe im Wehrmachtsgefängnis Fort Zinna verbüßt haben. Noch heute gibt es in Torgau die Fritz-Schmenkel-Straße. In der Erinnerungskultur der DDR war Fritz Schmenkel jedoch eine Ausnahme.
Fritz Schmenkel stammte aus einem kleinen Dorf in Pommern. Als er am 14. Februar 1916 geboren wurde, wies wenig darauf hin, dass er nicht einmal 30 Jahre später im Zweiten Weltkrieg als Partisan in den Wäldern Belarus’ gegen die deutsche Wehrmacht kämpfen würde. Die Staats- und Parteiführung der DDR ehrte ihn dafür seit den 1960er Jahren vielfach. Straßen, Betriebe, Schulen und Einheiten der NVA wurden nach ihm benannt, Büsten standen vor Schulen und auf öffentlichen Plätzen, die DEFA drehte 1978 den Film „Ich will euch sehen“ über ihn.
 Im Gefängnis in Torgau gründete sich eine Einheit der FDJ, die sich nach Fritz Schmenkel benannte und ein so genanntes Traditionskabinett anlegte. Hier wurden Schmenkels Verdienste gerühmt. Schmenkels Frau Erna war als Ehrengast aus Plauen angereist, als 1974 der FDJ-Gruppe feierlich der Name „Fritz Schmenkel“ verliehen und der Gedenkraum im Gefängnis eingeweiht wurde. Gerade diese vielen Ehrungen machen es aber schwierig, zur Person Fritz Schmenkel hinter dem Symbol durchzudringen.
Im Gefängnis in Torgau gründete sich eine Einheit der FDJ, die sich nach Fritz Schmenkel benannte und ein so genanntes Traditionskabinett anlegte. Hier wurden Schmenkels Verdienste gerühmt. Schmenkels Frau Erna war als Ehrengast aus Plauen angereist, als 1974 der FDJ-Gruppe feierlich der Name „Fritz Schmenkel“ verliehen und der Gedenkraum im Gefängnis eingeweiht wurde. Gerade diese vielen Ehrungen machen es aber schwierig, zur Person Fritz Schmenkel hinter dem Symbol durchzudringen.
Wir wissen nur wenig darüber, aus welchen Motiven der Wehrmachtsoldat Schmenkel 1942 die mutige Entscheidung traf, den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion nicht mehr mitzumachen. Nach seiner Heirat lebte er mit seiner Frau in Raudten, einer kleinen Stadt in Niederschlesien. Kurz nachdem er zur Wehrmacht eingezogen wurde, muss er von einem Kriegsgericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden sein. Belegt ist, dass er die Strafe im Wehrmachtsgefängnis Glatz (heute: Kłodzko) verbüßte. In der DDR setzte sich die Meinung fest, er sei in Torgau inhaftiert gewesen. Darauf lässt sich in den wenigen überlieferten Akten kein Hinweis finden. Aus dem Gefängnis kam er an die Front in der Nähe von Smolensk, wo er im Frühjahr 1942 zu den sowjetischen Partisanen überlief.
Nach dem Ende des Krieges schilderten Mitkämpferinnen, dass die Sowjets Schmenkel anfangs mit Misstrauen begegneten. Erst nach und nach wurde er bei Kampfeinsätzen als Maschinengewehrschütze einbezogen. Bei einem dieser Einsätze wurde er von deutschen Einheiten gefasst. Ein Kriegsgericht der Wehrmacht in Minsk verurteilte ihn zum Tode. Am 22. Februar 1944 wurde er dort erhängt. Dies galt als ehrloser Tod für Soldaten. Danach war er weitgehend vergessen. Seine Frau zog mit den drei Kindern nach Plauen und arbeitete dort in einer Textilfabrik.
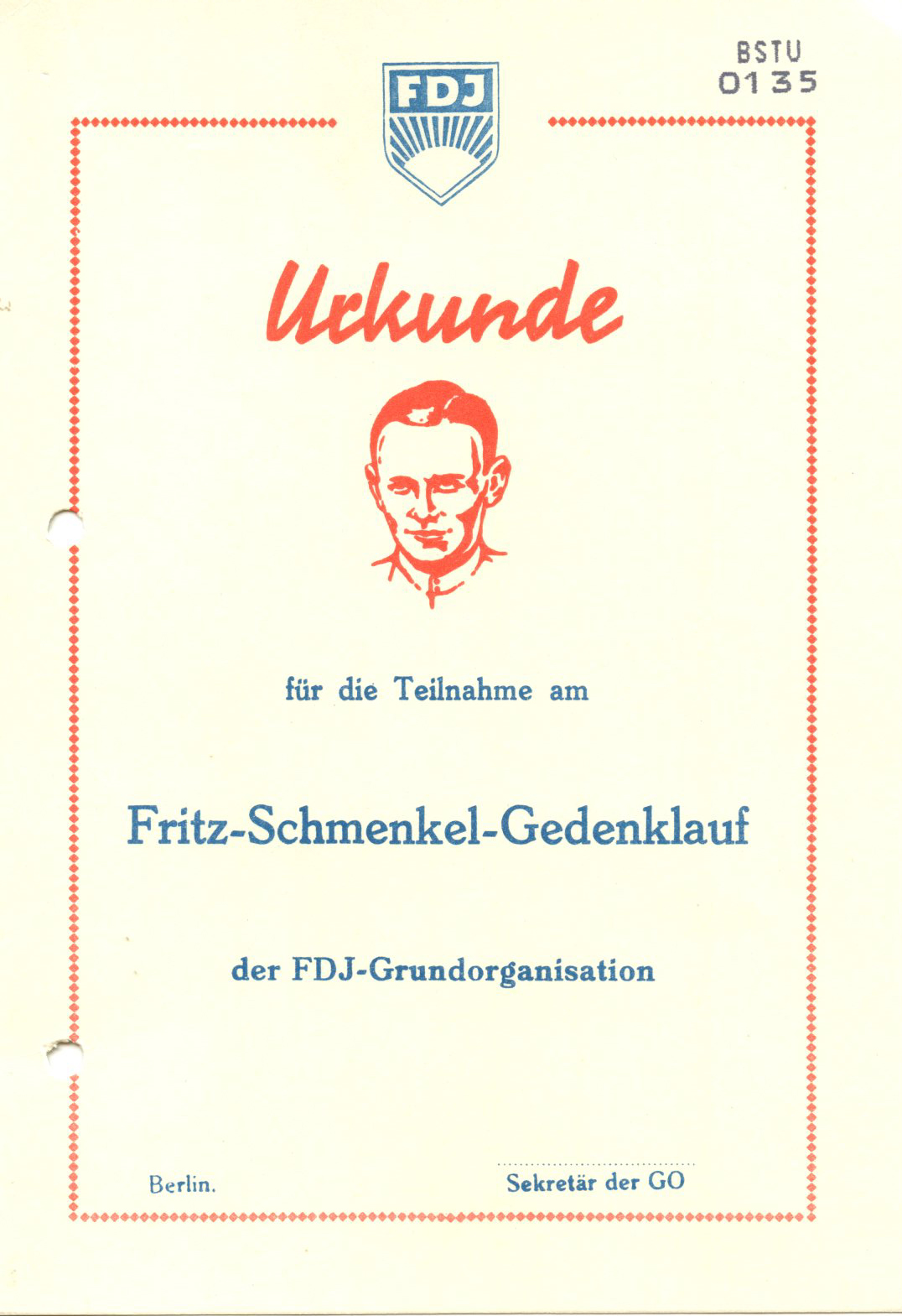 In den 1960er-Jahren besann man sich in der Sowjetunion wieder auf die Deutschen, die als Partisanen gegen die Wehrmacht kämpften. Fritz Schmenkel wurde 1964 posthum der Titel „Held der Sowjetunion” verliehen. Dies traf die Kulturbürokratie in der DDR unvorbereitet. Bis dahin waren Deserteure, Kriegsdienstverweigerer und sogenannte Wehrkraftzersetzer nicht ausdrücklich gewürdigt worden – zu sehr war die DDR darauf bedacht, selbst wieder militärische Tugenden zu fördern. Aus diesem Grund wurde pikanterweise auch Erna Schmenkel die Aufnahme in die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes lange verweigert. Ihr Mann sei ja nur Deserteur gewesen, lautete die Begründung.
In den 1960er-Jahren besann man sich in der Sowjetunion wieder auf die Deutschen, die als Partisanen gegen die Wehrmacht kämpften. Fritz Schmenkel wurde 1964 posthum der Titel „Held der Sowjetunion” verliehen. Dies traf die Kulturbürokratie in der DDR unvorbereitet. Bis dahin waren Deserteure, Kriegsdienstverweigerer und sogenannte Wehrkraftzersetzer nicht ausdrücklich gewürdigt worden – zu sehr war die DDR darauf bedacht, selbst wieder militärische Tugenden zu fördern. Aus diesem Grund wurde pikanterweise auch Erna Schmenkel die Aufnahme in die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes lange verweigert. Ihr Mann sei ja nur Deserteur gewesen, lautete die Begründung.
Bald wurde die Familie Schmenkels intensiv von der Stasi überwacht und betreut. Ein Offizier wurde eigens dazu abgestellt, mit Erna Schmenkel die Familiengeschichte durchzugehen und das Bild eines antifaschistischen Kämpfers mit möglichst lupenreiner Vergangenheit zu entwerfen. So wurde aus dem betrunkenen Vater, der mit der Pistole in der Hand die Polizei angegriffen hatte, ein Opfer des Faschismus. Schmenkel selbst wurde als ein glühender Kommunist dargestellt, der er möglicherweise nie gewesen war. All dies war der Stasi bewusst, die Zweifel und Widersprüche existieren aber nur als Randvermerke in den Akten. Nichts sollte das von oben verordnete Geschichtsbild stören.
Erna Schmenkel wurde zu einer begehrten Zeitzeugin und sprach bei FDJ-Treffen, vor Schülern und NVA-Soldaten. Sie und ihre Familie wurden mit Privilegien bedacht. Die Enkelkinder erhielten eine neue Wohnung, sie selbst kam in den Genuss von Kuraufenthalten in der Sowjetunion. Ein Sohn wurde in das Ministerium für Staatssicherheit aufgenommen und durfte in der „Bonzensiedlung“ in Wandlitz eine Wohnung beziehen. Dabei war sicher hilfreich, dass die Kontaktperson Erna Schmenkels bei der Stasi, Mielkes Stellvertreter Bruno Beater, selbst 1944 zur Roten Armee übergelaufen war. Die Person Fritz Schmenkel verschwand umso mehr im dichten Nebel des Antifaschismus, je mehr Büsten aufgestellt und Plaketten mit dem Konterfei verliehen wurden.
 Nach 1989 wurden viele Erinnerungszeichen abmontiert und Namensgebungen rückgängig gemacht. So verschwand Fritz Schmenkel ein zweites Mal: als ein Deserteur und Überläufer, der die mutige Entscheidung traf, den verbrecherischen Vernichtungskrieg der Deutschen nicht mehr mitzutragen.
Nach 1989 wurden viele Erinnerungszeichen abmontiert und Namensgebungen rückgängig gemacht. So verschwand Fritz Schmenkel ein zweites Mal: als ein Deserteur und Überläufer, der die mutige Entscheidung traf, den verbrecherischen Vernichtungskrieg der Deutschen nicht mehr mitzutragen.
Das Kalenderblatt wurde verfasst von Robert Parzer und Elisabeth Kohlhaas.
Kontakt:
Elisabeth Kohlhaas (DIZ Torgau, Ausstellungsbetreuung, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit)
Tel.: 03421 7739681
elisabeth.kohlhaas@stsg.de