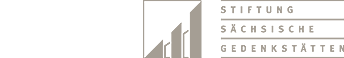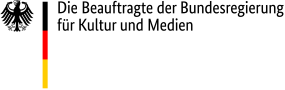November 2019
Ostern & Programm
90y Jahre Kampagne läuft ...
Inhalt |
Bevorstehende Veranstaltungen
31.10.2019 | „Was ist das Herz unserer Welt?“. Theaterperformance über Erinnerungskultur in der Gedenkstätte Münchner Platz Dresden (1. Vorstellung)

Die zwölfjährige Helga Pollak wurde 1943 zusammen mit ihrem Vater Otto Pollak in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Ihre Erlebnisse an diesem Schreckensort hat sie niedergeschrieben – 2014 wurden sie unter dem Titel „Mein Theresienstädter Tagebuch 1943–1944“ veröffentlicht. Aus den Texten Helga Pollaks, den Notizen ihres Vaters sowie auch Liedern der in Auschwitz ermordeten Dichterin Ilse Weber und tschechischen Volksliedern entstand eine Theaterperformance über Erinnerungskultur, die im Rahmen der 21. Tschechisch-Deutschen Kulturtage in Dresden aufgeführt wird.
> Mehr02.11.2019 | „Was ist das Herz unserer Welt?“. Theaterperformance über Erinnerungskultur in der Gedenkstätte Münchner Platz Dresden (2. Vorstellung)

Die zwölfjährige Helga Pollak wurde 1943 zusammen mit ihrem Vater Otto Pollak in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Ihre Erlebnisse an diesem Schreckensort hat sie niedergeschrieben – 2014 wurden sie unter dem Titel „Mein Theresienstädter Tagebuch 1943–1944“ veröffentlicht. Aus den Texten Helga Pollaks, den Notizen ihres Vaters sowie auch Liedern der in Auschwitz ermordeten Dichterin Ilse Weber und tschechischen Volksliedern entstand eine Theaterperformance über Erinnerungskultur, die im Rahmen der 21. Tschechisch-Deutschen Kulturtage in Dresden aufgeführt wird.
> Mehr05.11.2019 | Die „Kampfgruppen der Arbeiterklasse“ der DDR in der Friedlichen Revolution 1989 – Vortrag und Diskussion

Welche Rolle spielten im Herbst 1989 die betrieblichen „Kampfgruppen der Arbeiterklasse“ der DDR? Der Historiker Dr. Tilmann Siebeneichner, Freie Universität Berlin, wirft in seinem Vortrag einen Blick zurück auf die Lage vor 30 Jahren im Herbst 1989.
> Mehr05.11.2019 | Ausstellungseröffnung in Dresden: „Vom Mut in der Diktatur. Geschichten aus Tschechien, Deutschland, der Slowakei, Ungarn und Polen“

Was treibt dazu an, sich einem diktatorischen Regime entgegenzustellen und für demokratische Grundrechte einzutreten? Vorgestellt werden Menschen aus ehemaligen „Ostblockstaaten“, die den Mut dazu aufbrachten.
> Mehr06.11.–08.11.2019 | Internationaler Workshop: „Stätten der NS-Zwangsarbeit in Sachsen, Böhmen und Schlesien als archäologische Kulturdenkmale und Erinnerungsorte“

KZ-Außenlager und NS-Zwangsarbeitslager unterschiedlicher Kategorien sind bedeutende archäologische Kulturdenkmale. Sie waren Schauplätze unsäglicher menschlicher Erniedrigung und körperlicher Mißhandlung. Kriterien für den Umgang mit dieser bedeutenden Denkmalkategorie müssen von Archäologen, Denkmalpflegern, Gedenkstättenmitarbeitern und Historikern gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden. Es ist daher Ziel des Workshops, in einen intensiven Diskussionsprozess sowie in einen Austausch über Erfassungs-, Erschließungs- sowie Schutz-, Erhaltungs- und Gedenkkonzepte einzutreten.
> Mehr07.11.2019 | Lesung in Leipzig: Natascha Wodin „Irgendwo in diesem Dunkel“

Die Geschichte eines Mädchens, das als Tochter ehemaliger Zwangsarbeiter im Nachkriegsdeutschland lebt, wird von Natascha Wodin aus dem Rückblick erzählt, ausgehend vom Tod des Vaters der Protagonistin in einem deutschen Altenheim. Im Rahmen des internationalen Workshops „Stätten der NS-Zwangsarbeit in Sachsen, Böhmen und Schlesien als archäologische Kulturdenkmale und Erinnerungsorte“ laden wir zur öffentlichen Lesung ein.
> Mehr06.11.2019 | Auf den Spuren von Anna Štruncová. Rundgang durch die Gedenkstätte Münchner Platz Dresden mit Dr. Birgit Sack

Am 17. Juni 1944 wurde Anna Štruncová zusammen mit ihrer Mutter in den Frauenflügel der Haftanstalt am Münchner Platz in Dresden eingeliefert, die Mutter später zum Tode verurteilt und hingerichtet. Der von Gedenkstättenleiterin Dr. Birgit Sack kommentierte 60-minütige Rundgang folgt den Geschehnissen im Justizkomplex aus der Perspektive Anna Štruncovás (1922–2007).
> Mehr07.11.2019 | Der Weg der roten Fahne 3: Was haben wir davon? Die „Rote Fahne“, das Erbe der DDR und Dresdens Erinnerungskultur

Aufgrund seines deutlich ideologischen Gehalts stand das Wandbild „Der Weg der Roten Fahne“ schon bald nach 1989 zur Diskussion. „Der Weg der Roten Fahne“ führt eine Debatte um die Neuformierung des kulturellen Gedächtnisses der Stadt um lokale Identitäten und erlebte Geschichte weiter.
> Mehr13.11.2019 | „Ohne Ruhe rollt das Meer“ – Lesung und Konzert mit Gerhard Bause und Stephan Krawczyk anlässlich der Öffnung der Stasi-Sonderhaftanstalt Bautzen II vor 30 Jahren

Die Friedliche Revolution vor 30 Jahren in der DDR erfasste im Herbst 1989 auch die bis dahin von der Außenwelt hermetisch abgeriegelte Stasi-Sonderhaftanstalt Bautzen II. Gerhard Bause und Stephan Krawczyk widmen sich den Ereignissen aus künstlerischer Perspektive.
> Mehr12.11.2019 | 1989 - Die Friedliche Revolution in Dresden. Im Gespräch mit Dr. Herbert Wagner und Annemarie Müller

Im Rahmen dieser Diskussionsveranstaltung berichten Protagonisten des Herbstes 1989 von ihren Erlebnissen, Sorgen, Ängsten und Erfolgen 1989 in Dresden und der Zeit danach.
> Mehr13.11.2019 | „Im Strom der Zeit“ - Vermutungen über eine Flaschenpost

Beim Bau des Hafthauses am Münchner Platz in Dresden fügte der Maurer Otto Bercht 1904 eine Flaschenpost in die Wand ein. 1960 tauchte die Flaschenpost bei Umbauarbeiten wieder auf. Anlässlich des 60. Jahrestags ihres Bestehens präsentiert die Gedenkstätte den Film »Vermutungen über eine Flaschenpost«. Ein anschließendes Podiumsgespräch widmet sich dem Film und dessen Rolle für die Gedenkstätte in der DDR und die Erinnerungskultur in der SED-Diktatur.
> Mehr17.11.2019 | „Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen“ – Kammerkonzert und Lesung zum Volkstrauertrag in der Gedenkstätte Bautzen

Mit einem knapp eineinhalbstündigen Abend aus Lesung und Kammermusik möchten Roman Knižka und das Ensemble Opus 45 dazu anregen, sich mit rechtsextremer Gewalt auseinanderzusetzen. Anliegen des Programms ist es außerdem, der Opfer rechtsextremer Gewalt zu gedenken.
> Mehr26.11.2019 | Vortrag in Leipzig: Nationalsozialistische Arbeitskräftepolitik im besetzten Europa und Geschlecht

Aus der umfangreichen Forschung zum ‘Reichseinsatz’ ausländischer Arbeitskräfte geht hervor, dass der Anteil von Frauen an den polnischen und sowjetischen Arbeitskräften erheblich war. In ihrem Vortrag diskutiert Elizabeth Harvey einige Forschungsaspekte zur Rolle von Geschlecht bezüglich nationalsozialistischer Arbeitskräftepolitik im besetzten Europa.
> MehrNeuigkeiten aus der Stiftung und ihren Gedenkstätten
08.10.2019 | Vor 80 Jahren – Die Heil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein wird aufgelöst

Vor 80 Jahren, am 9. Oktober 1939 brach die Tradition des Pirna-Sonnensteins mit der offiziellen Auflösung der Heil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein durch das Sächsische Innenministerium ab. In einem Teil der Gebäude wurde im Frühjahr 1940 eine Tötungsanstalt eingerichtet. Ab dem 28. Juni 1940 wurden in einer Gaskammer im Keller des Gebäudes C16 Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen systematisch ermordet. Bis zum Abbruch der zentralen Krankenmorde am 24. August 1941 starben dort 14 751 Menschen, davon 1 000 KZ-Häftlinge.
> Mehr16.10.2019 | „Wir können es nicht abschütteln. Es bleibt ein Teil unserer Geschichte.“ Vortrag und Gespräch zu Frauen in KZ-Außenlagern

Am Abend des 9. Oktober 2019 sprach Dr. Andrea Rudorff, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fritz-Bauer-Institut, über Zwangsarbeit von Frauen in den Außenlagern des Konzentrationslagers Groß-Rosen in Niederschlesien. Ein Besucher aus dem Publikum richtete zum Schluss das Wort an die Referentin und die Gedenkstätte: „Wir können es nicht abschütteln. Es bleibt ein Teil unserer Geschichte. Ich bin dankbar für ihre Arbeit, denn sie trägt ein Teil zur Versöhnung der beiden Länder bei.“
> MehrNeuigkeiten aus weiteren zeitgeschichtlichen Orten in Sachsen
28.10.2019 | Eröffnung des Lichtraums Nr. 6 in Leipzig – 30 Jahre Friedliche Revolution

Im Rahmen des diesjährigen Lichtfestes zum 30. Jubiläum der Friedlichen Revolution beteiligte sich das Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V. in Kooperation mit dem Polnischen Institut Leipzig und dem Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig an der Gestaltung des Lichtraums Nr. 6, der im Schillerpark unter dem Motto „Für ein offenes Land mit freien Menschen“ stand.
> MehrImpressum
Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
Dülferstraße 1
01069 Dresden
Texte/Redaktion: Dr. Julia Spohr (Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
V.i.S.d.P.: Siegfried Reiprich (Geschäftsführer)
Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik? Kontaktieren Sie uns!
pressestelle@stsg.de
www.stsg.de
Facebook: facebook.com/StiftungGedenkstaettenSachsen
Twitter: twitter.com/gedenkstaetten
Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten erschließt, bewahrt und gestaltet historisch authentische Orte im Freistaat Sachsen, die an die Opfer politischer Verfolgung sowie an Opposition und Widerstand während der nationalsozialistischen Diktatur oder der kommunistischen Diktatur in der SBZ/DDR erinnern. Mit ihrer Arbeit will sie historische Informationen vermitteln, zur individuellen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit anregen sowie Engagement für Menschenrechte und Demokratie stärken. Zudem fördert sie Gedenkstätten, Archive und Initiativen in freier Trägerschaft sowie Projekte juristischer oder natürlicher Personen.
Nutzen Sie bitte diese Seite zum Bestellen bzw. Abbestellen des Newsletters.