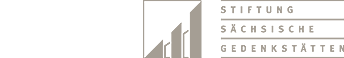Die Errichtung der „frühen“ Konzentrationslager im Frühjahr/Sommer 1933 in Sachsen

Über zwanzig dieser frühen Lager existierten in Sachsen, die vier bedeutendsten befanden sich in Hohnstein, Sachsenburg, Colditz und Zwickau-Osterstein. Die SA, die „Sturmabteilung“ der NSDAP, richtete sie an allen erdenklichen verfügbaren Orten ein: in Turnhallen, Kasernen, alten Fabrikgebäuden, Ferienheimen, Burgen und Schlössern. Willigten die ursprünglichen Betreiber, Nutzer oder Besitzer nicht ein, wurden sie oft selbst zu den ersten Gefangenen. Im Juli 1933 waren in Sachsen rund 4500 „Schutzhaftgefangene“ inhaftiert.
Einrichtung der „Schutzhaftzentrale“ und weitere Erlasse zur Regelung der „Schutzhaft“ und zur Errichtung von Konzentrationslagern in Sachsen

Nach der Anordnung vom 28. März 1933 sollten künftig allein die Polizeibehörden und verschiedene Verwaltungseinheiten für die Anordnung von „Schutzhaft“ zuständig sein. Die Einteilung der „Schutzhäftlinge“ erfolgte in drei Gruppen: erstens diejenigen, welche aus „unwesentlichen Gründen“ festgenommen worden waren, zweitens „Angehörige der marxistischen Parteien und Organisationen“, „die sich nicht führend betätigt haben“ und drittens „Funktionäre der marxistischen Parteien“ sowie Kriminelle. In der Praxis erfolgten jedoch weiterhin willkürliche Verhaftungen auch durch SA und SS, auch wurden die Mitglieder der Gruppen 1 und 2 nicht wie angekündigt entlassen. Die im letzten Abschnitt des Schreibens vom 28. März 1933 angekündigten Bestimmungen „über die Errichtung von Konzentrationslagern“ folgten am 19. April 1933.
Die „Vorläufigen Bestimmungen über die Errichtung und Verwaltung von Konzentrationslagern und Arbeitsdienstlagern“ enthielten beispielsweise umfangreiche und detaillierte Instruktionen darüber, wie die Häftlinge behandelt werden sollten. Unter Punkt IV. hieß es: „In den Lagern sind die Schutzhäftlinge streng aber gerecht und menschlich zu behandeln. Körperliche Züchtigung ist verboten.“ Dies wurde jedoch kaum beachtet, wurden doch die Gefangenen in denselben Bestimmungen als „Schädlinge am deutschen Volkskörper“ bezeichnet, bei denen eine „Sinnesänderung“ „aussichtslos erscheine“. Die „frühen“ Konzentrationslager waren Stätten massiver physischer und psychischer Gewalt gegen die Gefangenen. Zum einen gab es direkte körperliche Gewalt, also Schläge, Tritte, Prügelstrafe auf einem eigens entwickelten Prügelbock, Pfahlbinden bis hin zur Folter, die Häftlinge in ihren Erinnerungen als „Methoden des Mittelalters“ empfanden. Es gab verschiedene Arrestformen, verbunden mit Essenentzug und verschärfter Isolation, auch Dunkelhaft. Zahlreich waren entwürdigende Demütigungen und Schikanen: Haareschneiden im Knien, Unterbindung von Toilettenbesuchen, Strafexerzieren, Stehappelle, „Sport“ (z. B. Kniebeugen bis zum Umfallen) oder das sinnlose Ziehen von Loren oder Walzen unter verordnetem Gesang („singende Pferde“). Viele Gefangen überlebten diese Torturen nicht, nicht wenige von ihnen begingen Selbstmord.
Die sächsische Schutzhaftzentrale wurde am 8. März 1934 aufgelöst. Ihre Funktionen und Aufgaben übernahm nun zentralisiert das Geheime Staatspolizeiamt (Gestapo). Der dazu herausgegebene Schutzhafterlass enthielt Regelungen und Richtlinien, die für das gesamte Reichsgebiet galten. Den Häftlingen wurden in diesem Erlass jegliche Rechte, darunter das Beschwerderecht, entzogen, die bis dahin zumindest noch „auf dem Papier“ existiert hatten.
Auflösung der „frühen“ Konzentrationslager

Bedeutung
Die „frühen“ Konzentrationslager waren eines der wichtigsten Instrumente der Nationalsozialisten für die Machteroberung und Errichtung ihrer Diktatur. Sie waren Orte des unmittelbaren Terrors gegenüber politischen Gegnern des NS-Regimes und Mittel zur Einschüchterung der Bevölkerung. Ohne diese Lager ist die Zeit des Nationalsozialismus in den darauffolgenden Jahren nicht zu verstehen. Die Herausbildung einer politischen Opposition war auf lange Sicht kaum mehr möglich. Auch das Schweigen vieler Deutscher zu den Entwicklungen bis 1945 ist zum Teil damit zu erklären.
Literatur
Carina Baganz, Erziehung zur „Volksgemeinschaft“? Die frühen Konzentrationslager in Sachsen 1933-34/37, Berlin 2005.
Klaus Drobisch/Günther Wieland, System der NS-Konzentrationslager 1933–1939, Berlin 1993.
Kurt Kohlsche, „So war es! Das haben Sie nicht gewusst.“ Konzentrationslager Sachsenburg 1935/36 und Wehrmachtgefängnis Torgau-Fort Zinna 1944/45 – ein Häftlingsschicksal, Dresden 2001.
Johannes Tuchel, Organisationsgeschichte der „frühen“ Konzentrationslager, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hrsg.), Instrumentarium der Macht. Frühe Konzentrationslager 1933–1937, Berlin 2003, S. 9–26.