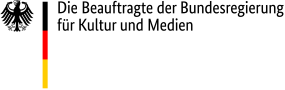Studierende des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus in der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein
07.11.22

Wie kam es dazu, dass sich Ärzte im Nationalsozialismus am hunderttausendfachen Mord beteiligten? Darüber informierten sich am 7. November 2022 angehende Medizinerinnen und Mediziner des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden in der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein. Organisiert vom Institut für Geschichte der Medizin ist dieser Besuch Teil der Vorlesung „Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin“. Der Besuch bildet den Auftakt für eine Zusammenarbeit zwischen der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein und dem von Prof. Dr. Florian Bruns geleiteten Institut für Geschichte der Medizin.
Die Teilnehmenden erhielten in der Gedenkstätte einen Überblick zur Vorgeschichte, Planung und Umsetzung der nationalsozialistischen Krankenmorde in Pirna-Sonnenstein. Allein dort starben 1940 und 1941 knapp 15 000 Menschen in einer Gaskammer. Die Opfer waren zuvor von Ärzten als „lebensunwert“ ausgesondert worden.
Insbesondere die nationalsozialistischen Krankenmorde unterstreichen die Bedeutung der Auseinandersetzung mit der Geschichte des eigenen Faches. Bis heute ist ärztliches Handeln mit zahlreichen ethischen Fragen verbunden. Dafür zu sensibilisieren, ist uns als Gedenkstätte ein wichtiges Anliegen und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!
Kontakt:
Hagen Markwardt (Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein, Öffentlichkeitsarbeit)
presse.pirna@stsg.de
Tel. 03501 710963