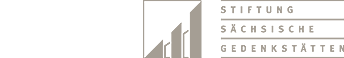Demokratie und Revolution
Wenn man etwas aus der Geschichte lernen kann, dann auch dies: Die menschliche Gesellschaft entwickelt sich nicht gesetzmäßig zum Besseren, zum Fortschritt. Stattdessen gibt es Aufstieg und Untergang, Fort- und Rückschritt, Wandel zum Besseren und zum Schlechteren. Fortschritt ist kein Naturgesetz. Was die eine Generation errungen, werden folgende wieder verlieren. Geschichte vollzieht sich nicht stetig, sondern sprunghaft.
Mit Marx sind „Revolutionen die Lokomotive der Geschichte“. Nicht immer verändern sie die Gesellschaft zum Besseren, abgesehen von dem Chaos, in das sie diese Gesellschaften zumeist stürzen, weshalb ihnen Reformismus grundsätzlich vorzuziehen ist.
Politische Revolutionen haben eine jahrelange Vorgeschichte und ereignen sich dann gleichwohl unvorhersehbar. Wenn sie ausbrechen, sind sie kaum noch steuerbar. Was jahrzehnte-, ja jahrhundertelang als unveränderbar galt, wird in wenigen Wochen, gar Tagen über den Haufen geworfen. Scheinbar Stabiles erweist sich als brüchiges Kartenhaus. Sowohl die Herrschenden als auch die Revolutionäre werden von der Dynamik der Ereignisse überrascht. Wohl kaum ein französischer Adliger konnte sich im Sommer 1788 vorstellen, dass die Königsfamilie unter der Guillotine sterben würde. Das Politbüro der SED, aber auch die Montagsdemonstranten in der DDR, konnten sich im Sommer 1989 nicht vorstellen, dass Deutschland ein Jahr später unter einer konservativ-liberalen Regierung vereint sein würde. Aber auch die Nationalsozialisten dachten im Frühjahr 1932 mehrheitlich nicht im Traum daran, weniger als ein Jahr später den Posten des Reichskanzlers zu erobern.
Im Nachhinein scheint vieles nur folgerichtig, aber solche Kausalitäts-Konstrukte führen in die Irre, Zufälle spielen eine weitaus größere Rolle, als die Geschichtsschreibung später einräumt. Alternative Historien kommen in den Geschichtsbüchern nicht mehr vor, obwohl sie möglich waren.
Was verursacht Revolutionen, wie kommt es zu dramatischen Veränderungen in kürzester Zeit? Das Platonsche Revolutions-“Gesetz“ besagt, man könne keine erfolgreiche Revolution durchführen, wenn die herrschende Klasse nicht durch innere Zwietracht oder eine Niederlage in einem Krieg geschwächt sei. Monarchien und autoritäre Diktaturen sind besonders gefährdet, wenn der König bzw. der Führer sterben. Revolutionen folgen keinem theoretischen Plan (die Theorien folgen erst später), sondern sind in der Regel Ausdruck von sozialen Interessenkonflikten. Revolutionen werden von Bauern, Handwerkern, Soldaten, Arbeitern oder anderen Ständen und Klassen „gemacht“. Sie schließen sich zu sozialen Bewegungen zusammen, manchmal gebären sie charismatische Führer. Nicht immer und selten allein geht es dabei um wirtschaftliche Notlagen, wie Hunger. Auch ein als ungerecht empfundenes Steuersystem oder überbordene Staatsschulden können Revolutionen auslösen. Die politischen Veränderungen, die schließlich in Revolutionen realisiert werden, können sich jahre- gar jahrzehntelang quasi unmerklich bereits zu einem gewissen Grade unerkannt in der Gesellschaft vollzogen haben. Oft sind es erst die Reaktionen der Herrschenden auf erste „Problemanzeigen“, die "das Fass zum Überlaufen" bringen. Wenn der letzte Tropfen aber gefallen ist, ist es zum „Dampfablassen“ in der Regel zu spät. Oder, wie Alexis de Tocqueville 1856 in „Der alte Staat und die Revolution“ schrieb: „Die Erfahrung lehrt, dass der gefährlichste Augenblick für eine schlechte Regierung gewöhnlich der ist, in dem sie sich zu reformieren beginnt.“ Gorbatschow hatte hiervon keine Ahnung, als er mit seiner Perestroika begann.
Kommt es auch in Demokratien zu revolutionären Situationen? Einerseits wird eine derartige Zuspitzung dadurch gebremst, dass Unmut, Unruhe und Unzufriedenheit in demokratischen Gesellschaften nicht unterdrückt werden, wie in scheinbar stabilen autoritären Systemen, in denen sich die unterdrückten Probleme dann umso stärker explosiv entladen. Demgegenüber können in Demokratien Fehlentwicklungen, Missstände und Konflikte korrigiert bzw. gelöst oder zumindest abgemildert werden, bevor sie sich zu großen Problemen mit katastrophalen Folgen für das Gesamtsystem entwickeln. Demokratien ermöglichen in diesem Sinne Reformen per „Stückwerk-Technik“ (Karl R. Popper). Diese können sich auf gesellschaftliche Probleme (hypertrophes Bankensystem), aber auch auf das Regierungshandeln im demokratischen politischen System selbst beziehen, zum Beispiel die Ergänzung parlamentarischer Entscheidungsfindung durch plebiszitäre Elemente. (ungeachtet der Gefahr eine plebiszitären Diktatur).
Wenn sich aber große Bevölkerungsgruppen von der Demokratie als Regierungsform bzw. als Prinzip der Entscheidungsfindung abwenden, weil Finanz-, Wirtschafts- oder außenpolitische Krisen zu sozialen Verwerfungen oder auch nur zu massiven Ängsten davor führen oder das Vertrauen in ihre Problem- und Konfliktlösungsfähigkeit oder in ihre Überlegenheit gegenüber anderen Regierungsformen zerstören, dann können auch Demokratien scheitern und auf parlamentarischem oder revolutionärem Wege abgeschafft werden.
Bert Pampel, 12. Februar 2015