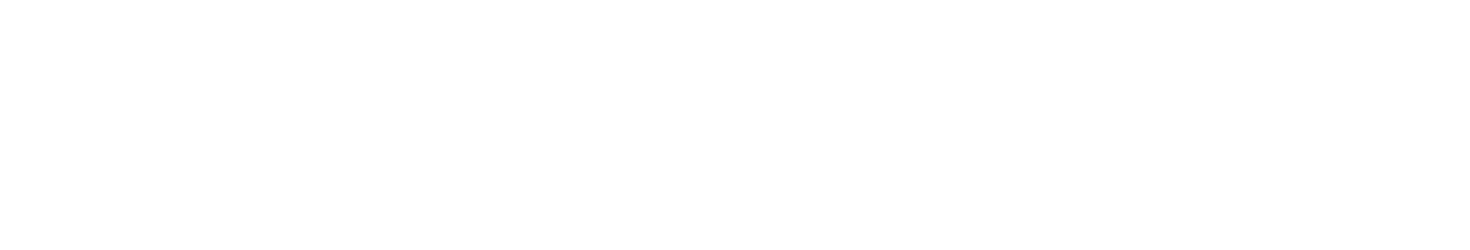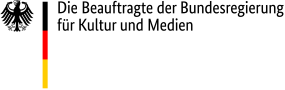Von der Anstaltsgründung über den Ersten Weltkrieg zur Reformpsychiatrie der Weimarer Republik
Die Heil- und Pflegeanstalt Großschweidnitz diente seit 1902 der Unterbringung und Behandlung psychisch kranker Menschen. Es war eine moderne staatliche Einrichtung. Die im Pavillonstil errichtete Anstalt mit ihren großzügigen Parkanlagen bot zunächst Platz für 500 Patientinnen und Patienten. Sie kamen vor allem aus Ostsachsen.
Diese Entwicklung stieß auch auf Kritik. Zum einen galten die Kosten für die Anstalten als zu hoch. Zum anderen schürten insbesondere Rassenhygieniker Ängste vor einer drohenden Degeneration des deutschen Volkes, die durch die vermeintliche Zunahme psychisch kranker Menschen zum Ausdruck käme. Viele psychische Erkrankungen und Behinderungen galten als vererbbar.
Der Erste Weltkrieg markierte auch für Großschweidnitz einen tiefen Einschnitt. Infolge der Lebensmittelrationierungen kam es zur Hungerkatastrophe. Über 1 000 Anstaltspatientinnen und -patienten verloren zwischen 1914 und 1918 ihr Leben.
Während der Weimarer Republik hielten auch in Großschweidnitz neue Therapien Einzug. Allerdings blieben diese auf die als „heilbar“ betrachteten Menschen begrenzt. Gleichzeitig erlebte die Rassenhygiene einen Aufschwung. Forderungen nach Sterilisation „minderwertiger“ Menschen wurden laut. Sogar die „Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ wurde gefordert. Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Krisenzeiten gerieten auch die Kosten der Anstaltspflege immer stärker in die Kritik.
Nationalsozialistische Gesundheitspolitik und Krankenmorde in Großschweidnitz
Die Nationalsozialisten griffen die lange diskutierten rassenhygienische Forderungen auf und machten sie im Zuge der Machtübernahme 1933 zum Kern ihrer Gesundheitspolitik. Es sollte eine gesunde deutsche „Volksgemeinschaft“ entstehen. Menschen mit geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen hatten in dieser keinen Platz. Seit 1934 wurden hunderttausende vermeintlich „Erbkranke“ zwangsweise sterilisiert. Die Propaganda stellte sie als Gefahr und „unnütze Esser“ dar. Arbeitsunfähige Patientinnen und Patienten erhielten in Sachsen seit 1938 nur noch eine „Sonderkost“, einen kalorienreduzierten Gemüsebrei. Für viele in Großschweidnitz untergebrachte Menschen wurde der Hunger zum Alltag.
Die Entscheidung, Psychiatriepatientinnen und -patienten gezielt zu ermorden, fiel kurz nach Kriegsbeginn 1939. Adolf Hitler persönlich ordnete an, dass Menschen mit geistigen Behinderungen und psychischen Erkrankungen getötet werden sollten. Es kam zum ersten systematischen Massenmord des Nationalsozialismus. In sechs zentralen Tötungsanstalten starben über 70 000 Menschen qualvoll in Gaskammern. Eine Tötungsanstalt befand sich seit Juni 1940 in Pirna-Sonnenstein. Für diese diente Großschweidnitz als „Zwischenanstalt“. Sie nahm Patientinnen und Patienten, vor allem aus Sachsen, Schlesien und Ostpreußen, auf, um diese dann kurze Zeit später nach Pirna weiter zu verlegen. Über 2 300 Menschen gelangten so aus Großschweidnitz nach Pirna-Sonnenstein. Im August 1941 befahl Hitler den Abbruch der zentralen Krankenmorde. Dies bedeutete allerdings nicht das Ende des Sterbens in den Heil- und Pflegeanstalten. Die Morde wurden mit anderen Mitteln fortgeführt.
In Großschweidnitz kam es bereits im Winter 1940 zu einer ersten Mordaktion. Die Opfer waren Kinder, die im Herbst 1940 aus dem aufgelösten Katharinenhof Großhennersdorf nach Großschweidnitz verlegt worden waren. Ärztinnen und Schwestern ermordeten sie durch überdosierte Beruhigungsmittel.
Im Verlauf des Krieges starben immer mehr Menschen in der Anstalt. Die Sterblichkeit lag bei nahezu 50 Prozent. Unter der Leitung des Direktors Alfred Schulz ermordeten Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und Pfleger die ihnen anvertrauten Menschen durch überdosierte Beruhigungsmittel, Vernachlässigung und Hunger. Es war ein medikalisiertes Töten an dem die Schwestern und Pfleger unmittelbar beteiligt waren. Betroffen waren vor allem arbeitsunfähige, pflegeaufwendige und störende Personen. Sie wurden bei den täglichen Visiten selektiert und es genügte, wenn der diensthabende Arzt der Schwester im Einvernehmen sagte: „Hier geben wir Medizin“.
Die Opfer kamen aus vielen Teilen des Deutschen Reiches. Sie waren im Rahmen der zentralen Krankenmorde nach Großschweidnitz gelangt oder im Zuge der Evakuierung aus bombengefährdeten Gebieten, zum Beispiel dem Rheinland, nach Großschweidnitz abgeschoben worden. Auch Menschen aus Polen, der Sowjetunion oder Italien waren unter den Opfern. Sie waren zur Zwangsarbeit in das Deutsche Reich verschleppt worden und kamen infolge einer psychischen Erkrankung nach Großschweidnitz. Konnte dort ihre Arbeitsfähigkeit nicht rasch wieder hergestellt werden, war dies ihr Todesurteil.
Seit 1943 befand sich in Großschweidnitz auch eine „Kinderfachabteilung“. Die dort eingewiesenen Kinder wurden begutachtet und in den meisten Fällen ermordet.
Kurz vor Kriegsende brach die Versorgung der Patientinnen und Patienten fast vollständig zusammen. In den letzten vier Monaten vor Kriegsende kamen fast 1 000 Menschen ums Leben.
Viele der Opfer wurden auf dem Anstaltsfriedhof beigesetzt. Dort erinnern heute Namenstafeln an die Ermordeten.
Nachkriegszeit
Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand die Anstalt fort. Die Unterbringungs- und Versorgungssituation blieb zunächst schlecht, sodass die Sterblichkeit auch noch in den folgenden Jahren sehr hoch war. Einige an den Krankenmorden beteiligte Ärzte, Ärztinnen, Schwestern und Pfleger wurden im Dresdner „Euthanasie“-Prozess 1947 angeklagt und verurteilt. Viele blieben aber unbehelligt und betreuten die wenigen Überlebenden der Krankenmorde weiter. Diese erfuhren auch weiterhin eine Stigmatisierung. Eine Anerkennung und Wiedergutmachung ihres Leides erfolgte nicht.
Heute befindet sich auf dem Gelände das Sächsische Krankenhaus Großschweidnitz.