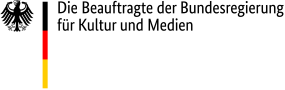Projektarbeit/Seminare
- „Augen sagen mehr ...“ – Gestalten einer Gedenktafel
- Opfer, Täter und die Gesellschaft (Vertiefung I)
- Opfer, Täter und die Gesellschaft (Vertiefung II)
- Diskussionsstationen
- Pflege im Nationalsozialismus. Die Beteiligung von Pflegepersonal an den nationalsozialistischen Krankenmorden
- Sprühen der Gedenkspur
„Augen sagen mehr ...“ – Gestalten einer Gedenktafel

Die Teilnehmenden wählen in Kleingruppen eine Fotografie eines Augenpaares eines Opfers der nationalsozialistischen „Euthanasie“ aus. Sie begeben sich innerhalb der Gedenkstätte auf eine Spurensuche nach dem Menschen, zu dem das Augenpaar gehört. Anschließend setzen sich die Kleingruppen anhand einer Biografie und Quellen eingehender mit dem individuellen Lebenslauf und Schicksal auseinander.
Mit verschiedenen Materialien gestalten sie eine Gedenktafel, die an diese Person erinnert und ihre persönliche Lebensgeschichte hervorhebt. Zum Abschluss stellen sie dieses individuelle Schicksal den anderen Gruppen vor. Die Gedenktafeln können nach dem Projekt mitgenommen und beispielsweise in der jeweiligen Schule ausgestellt werden.
Empfohlen für: Sekundarstufe I (ab Klasse 8)
Dauer: ca. zwei Stunden
Opfer, Täter und die Gesellschaft (Vertiefung I)
Mittels einzelner Biografien wird die Perspektive der Verfolgten und ihrer Angehörigen in der Zeit des Nationalsozialismus beleuchtet. Zugleich rückt das Projekt in den Blick, welche Verantwortung die Akteure der „Aktion T4“ übernahmen und stellt die Frage nach dem Verhalten der Öffentlichkeit.
In Kleingruppen erkunden die Teilnehmenden selbstständig verschiedene Vermittlungsebenen der Dauerausstellung und setzen sich unter Anleitung mit historischem Bild- und Quellenmaterial auseinander.
Empfohlen für: Sekundarstufe I (ab Klasse 9), Berufsschulen
Dauer: ca. zwei Stunden
Opfer, Täter und die Gesellschaft (Vertiefung II)
Unter welchen Bedingungen konnte die Verfolgung psychisch kranker und geistig behinderter Menschen bis zu den „Euthanasie“-Morden mitten in der deutschen Gesellschaft stattfinden? Was bedeutete die Ausgrenzungspolitik für die Verfolgten? Welche Verantwortung kam den Einzelnen als Akteuren oder Mitwissenden zu? Welche Handlungsspielräume hatten sie? Wie reagierte die Öffentlichkeit auf die Verbrechen? In Kleingruppen arbeiten die Teilnehmenden selbstständig mit historischem Quellenmaterial und Biografien. Ziel ist es, durch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen historischen Perspektiven ein differenzierteres Bild zu gewinnen und ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein zu fördern.
Empfohlen für Sekundarstufe II, Berufsschulen
Dauer: ca. zwei Stunden
Diskussionsstationen
 Das Projekt verbindet historische und ethische Fragestellungen mit einem thematischen Gegenwartsbezug. Alle Teilnehmenden sind aufgefordert, zu einzelnen Themenbereichen Stellung zu beziehen sowie Fragen und Denkanstöße aus ihrer persönlichen Sicht zu kommentieren und unterschiedliche Standpunkte zu diskutieren. Die Form der Diskussionsstationen ist bewusst offen gewählt und gibt keine „richtigen“ Antworten vor. Die Teilnehmenden diskutieren die damaligen Motive der Mitarbeiter der Tötungsanstalt und die Verantwortung der Einwohner Pirnas ebenso wie die Rolle, die Rassismus und Ausgrenzung Anderer in unserer heutigen Gesellschaft noch spielt. Ganz konkret werden verschiedene Stufen der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung anschaulich vorgestellt und erörtert. Themen sind auch Sterbehilfe und Aspekte der vorgeburtlichen Gendiagnostik.
Das Projekt verbindet historische und ethische Fragestellungen mit einem thematischen Gegenwartsbezug. Alle Teilnehmenden sind aufgefordert, zu einzelnen Themenbereichen Stellung zu beziehen sowie Fragen und Denkanstöße aus ihrer persönlichen Sicht zu kommentieren und unterschiedliche Standpunkte zu diskutieren. Die Form der Diskussionsstationen ist bewusst offen gewählt und gibt keine „richtigen“ Antworten vor. Die Teilnehmenden diskutieren die damaligen Motive der Mitarbeiter der Tötungsanstalt und die Verantwortung der Einwohner Pirnas ebenso wie die Rolle, die Rassismus und Ausgrenzung Anderer in unserer heutigen Gesellschaft noch spielt. Ganz konkret werden verschiedene Stufen der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung anschaulich vorgestellt und erörtert. Themen sind auch Sterbehilfe und Aspekte der vorgeburtlichen Gendiagnostik.
Empfohlen für Sekundarstufe II, Berufsschulen, FSJ-Gruppen
Dauer: ca. zwei Stunden
Pflege im Nationalsozialismus. Die Beteiligung von Pflegepersonal an den nationalsozialistischen Krankenmorden
Die Mitarbeit von Pflegepersonal war wesentlich für die Umsetzung der nationalsozialistischen Krankenmorde. Pfleger und Schwestern beteiligten sich während der „Aktion T4“ am Transport der Opfer und führten sie in die Gaskammer. In der dezentralen Phase der Krankenmorde wirkten sie direkt an der Selektion mit und verabreichten gezielt überdosierte Medikamente.
Das gemeinsam mit der Gedenkstätte Großschweidnitz erarbeitete Projekt richtet sich vor allem an Auszubildende und Personen, die in pflegenden und sozialen Berufen tätig sind. In Kleingruppen lernen die Teilnehmenden Formen der Mitwirkung des Pflegepersonals an den Krankenmorden, aber auch den historischen Arbeitskontext, das Berufsbild und Formen der Stigmatisierung von psychisch kranken oder geistig beeinträchtigten Menschen kennen. Das historische Wissen ermöglicht eine tiefergehende Reflexion gegenwärtiger berufsethischer An- und Herausforderungen in pflegenden Berufen.
Empfohlen für Berufsschulen, berufliche Weiterbildung (insbesondere in pflegenden und sozialen Berufen)
Dauer: ca. drei Stunden
Sprühen der Gedenkspur
 Seit dem Jahr 2002 führt eine Gedenkspur aus 14 751 bunten Kreuzen durch Pirna. Sie markiert einen Weg von der Gedenkstätte quer durch die Altstadt bis zur Elbe. Für jedes Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“- Verbrechen wurde ein buntes Kreuz auf den Weg gemalt oder gesprayt. Die Gedenkstätte lädt in Kooperation mit dem Pirnaer Verein „Aktion Zivilcourage e.V.“ interessierte Gruppen oder Schulklassen dazu ein, die Gedenkspur immer wieder zu erneuern. Denn die Kreuze verblassen durch die Witterung mit der Zeit. Damit ist die Spur durch Pirna ein ganz konkretes Symbol dafür, dass das Engagement gegen das Vergessen für uns eine bleibende Aufgabe bleibt. Kontakt Aktion Zivilcourage e.V.: jana.wagner@aktion-zivilcourage.de
Seit dem Jahr 2002 führt eine Gedenkspur aus 14 751 bunten Kreuzen durch Pirna. Sie markiert einen Weg von der Gedenkstätte quer durch die Altstadt bis zur Elbe. Für jedes Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“- Verbrechen wurde ein buntes Kreuz auf den Weg gemalt oder gesprayt. Die Gedenkstätte lädt in Kooperation mit dem Pirnaer Verein „Aktion Zivilcourage e.V.“ interessierte Gruppen oder Schulklassen dazu ein, die Gedenkspur immer wieder zu erneuern. Denn die Kreuze verblassen durch die Witterung mit der Zeit. Damit ist die Spur durch Pirna ein ganz konkretes Symbol dafür, dass das Engagement gegen das Vergessen für uns eine bleibende Aufgabe bleibt. Kontakt Aktion Zivilcourage e.V.: jana.wagner@aktion-zivilcourage.de
Empfohlen für Sekundarstufe I und II, Ausbildungsberufe, FSJ-Gruppen
Dauer. ca. zwei Stunden
Pädagogisches Angebot der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein (271 KB)
>> Online-Anmeldung für Führungen/Projekte
Kontakt:
Hagen Markwardt (Wissenschaftliche Dokumentation, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit)
Tel.: 03501 710963
hagen.markwardt@stsg.de