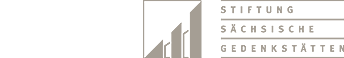26.06.14
Horst Kreeter
Torgau Fort Zinna
Nach der Verurteilung 1956 (Artikel 6 der Verfassung der DDR) kam ich nach Torgau an der Elbe. Eine alte Festung mit hohen Mauern und tiefen Wallgräben. Der Innenbau ist ein Kreuzbau und wurde unter Hitler zur Offiziershaftanstalt umgebaut. Fast nur Einzelzellen mit Hochklappbarem Metallbett an der einen Seitenwand. Parkettfußboden. Wasserkasten Spültoilette. Daneben Waschbecken mit fließend kaltem Wasser. In diesen Einzellzellen lagen die ganzen Jahre immer 3 Gefangene. Man hatte dazu 2 schmale Holzbetten übereinander unter dem hochgelegenen Fenster zusätzlich untergebracht. Für 3 war die Zelle sehr eng und widersprach den internationalen Vorschriften. Der DDR scherte das wenig.
Als Neuzugang ich kam dort erst einmal in eine Einzelzelle auf der Station 1, die Isolier –und Arreststation. Zusätzlich zu den eingenähten grünen Längsstreifen der Drillichjacke und Hose einen breiten roten Streifen, eingenäht um den linken Oberarm und rechten Oberschenkel. Das Zeichen für unbestimmte Zeit strenge Isolierhaft für jeden ankommenden politischen Häftling, die es ja offiziell in der DDR nicht gab. Ich hatte auf der Zelle eine Alu-Schüssel, dazu einen Alu-Löffel. Ein Stück Kernseife und eine Zahnbürste mit Holzstiel. Als Zahnpasta ein viereckiges Stück Rosodent, ca. 4x4x1 cm groß, fest und rosarot in einem flachen Plaste Etui. Man musste das Stück Rosodent mit Wasser benetzen und mit der Zahnbürste reiben bis es cremig wurde. Ich kannte das schon vom Krieg her, als es keine Zahnpaste mehr gab. Hier wollte man wohl die letzten Bestände aufbrauchen. Die Holzbetten bestückt mit Strohsäcke und drei Decken. Im Winter wurde eine Decke dazu ausgegeben. Schuhe für die halbe Stunde Freigang jeden Tag auf dem Hof aus Leinen mit Holzsohlen bis über die Knöcheln reichend (nur auf der Isolierstation). Für die Zelle gebrauchte Pantoffeln. Das war alles.
Wenn die Zelle aufgeschlossen wurde musste ich melden: „Zelle Nr. sowieso, belegt mit einem Strafgefangenen, keine besonderen Vorkommnisse, es meldet Strafgefangener Kreeter!“ Man hatte zwar den Militarismus abgeschworen, bediente sich aber seinen Methoden. Abends musste die Jacke und Hose als Päckchen auf den Hocker gebaut werden. Oben auf kam die Schüssel mit der Öffnung nach unten und zwischen Jacke und Hose wurde der Löffel gesteckt. Das kam dann vor die Tür. Die Zellentüren wurden immer verschlossen. Auch auf den normal Stationen. Das blieb die ganzen Jahre so. Weil die DDR die Arbeitskraft der Häftlinge brauchte wurden in den Haftanstalten Zweigbetriebe der staatlichen Betriebe aufgebaut. Arbeiten war Pflicht, wer es ablehnte kam in Arrest. Dadurch verkürzte sich meine Einzelhaft auf ein paar Monate. Ich kam in das Kommando Kfz-Meißen. Meist so um die 200 Häftlinge fertigten an entsprechenden Maschinen in einer flachen Werkshalle Kraftfahrzeug Ersatzteile. Die Halle stand gleich neben dem Kreuzbau, also innerhalb des Schießstreifens und der hohen Außenmauer. Übrigens, alle Wände der Gebäude einschließlich der 2. Etage nebst Mauer waren weiß gestrichen. Nachts waren Schatten besser auszumachen. Die weiße Innenseite der Mauer war nachts zusätzlich beleuchtet. Die tägliche Freistunde sah so aus. Wir marschierten in Dreierreihen um ein Rondell in der der Mitte des Hofes, ca. eine halbe Stunde lang. Durch die weißen Flächen ringsum kam ich mir vor wie in Afrika. Dort sind bekanntlich die Mauern und Häuser auch weiß gestrichen, jedoch um die Sonnenstrahlen zu reflektieren.
Ich möchte noch zwei andere Kommandos der Haftanstalt Anstalt Torgau erwähnen. Einmal das Techniker Kommando, die arbeiteten als Technische Zeichner und Teilkonstrukteure für die Optischen Werke Jena und das Kommando Rackwitz. Eine Aluminium Schleiferei aus Leipzig. Sehr schmutzintensiv.
Wir im Kommando Meißen arbeiteten in drei wechselnde Schichten (Spät-Früh-Nachtschicht) und einer Tagesschicht. Bevor man uns auf metallbearbeitende Maschinen losließ kamen wir erst in ein Lehrkommando. Dort wurden wir ein paar Wochen an verschiedenen Drehmaschinen und andere spanabhebende Maschinen angelernt. Dann ging es in die Fertigung. Ich arbeitete die nächsten Jahre an Drehmaschinen.
Meister, Schichtführer, Arbeitsvorbereitung machten alles wir Häftlinge. Wir hatten einen Werkzeugbau in dem Werkzeuge, die wir für die Produktion brauchten, von uns gefertigt wurden. Es wurde nach Leistung gearbeitet wie im Hauptwerk in Meißen und nach Zeit-Norm. Wir waren die Sklaven der DDR; denn es gab ja keinen Urlaub und die angefallenen Krankenstunden wurden zum Jahresende in sonntäglichen Sonderschichten aufgearbeitet. Dreiviertel des Verdienstes behielt die Anstalt. Von mir in den fast 8 Jahren Arbeit ca. 20.000,- Mark (Ost). Trotz östlicher Rehabilitierung nach der Wiedervereinigung ist mir bisher dieses Geld vorenthalten worden. Es gibt dafür kein Gesetzt teile mir der Petitionausschuss des Bundestages auf meinen Antrag hin mit. Der damalige Bundespräsident meinte, man könne es leider nicht allen Menschen recht machen. Auch eine freiheitliche Demokratie, für die wir uns ja eingesetzt hatten, ist manchmal sehr gewöhnungsbedürftig.
Nach 2 Jahren 3 Schichtarbeit bekam ich heftige Magenprobleme. Einer der zwei Ärzte vom Stadtkrankenhaus Torgau, die zweimal in der Woche abends auf der Krankenstation untersuchten, schrieb mich Nachtschichtunfähig. Ich kam dann in den 2 Schichtbetrieb, d. h. Früh –und Spätschicht. Dadurch lernte ich mit der Zeit alle kennen die im Kommando Meißen arbeiteten. Ich konnte somit mehr interne Kontakte pflegen. Das ist viel in solcher Situation. Wir bauten uns gegenseitig auf.
Als ich nach Torgau kam waren die meisten der ca. 1500 Häftlinge die vom sowjetischen Militär Tribunal verurteilte, Tribunale oder SMT-ler genannt. Dann kamen wir, von der DDR nach Artikel 6 der Verfassung verurteilte. Darunter fielen auch Zeugen Jehovas. Die wurden schon unter den Nazis verfolgt und nun wieder. Und noch einige wegen Wirtschaftvergehen verurteilte. Alles willkürliche, politische Urteil. Kriminelle kaum. Ende 1956 wurden viele Tribunale entlassen. Einige saßen schon 10 Jahre ein. In den nächsten Jahren kamen mehr Kriminelle nach Torgau. Auch zum Tode verurteilte Mörder. Sie wurden mit einem Fallbeil, das in einem grünlichen Armeelastwagen montiert war, nachts hingerichtet. Ein Wärter von kräftiger Statur, der auch bei unserem Kommando Dienst tat, hatte das mal angedeutet. Sie brauchten dafür kräftige Leute, weil manche Deliquenten vorher noch um sich schlugen.
Meine Magenprobleme blieben. Ich bekam jedes Jahr ein bis zweimal ein kleines sichelförmiges Zwölffingerdarmgeschwür am Magenausgang. Ein ulcus duodeni. Festgehalten von einem alten Röntgengerät das wohl irgendwo ausgemustert den Weg in die Haftanstalt gefunden hatte. Da wurde mein „ulcus duodeni“ jedes Mal von allen Seiten mit Röntgenstrahlen fotografiert. Es ging jahrelang so. Nach heutigen Erkenntnissen müsste ich damals schon innen geleuchtet haben.
Die zurückbleibenden Narben verhärteten den Zwölffingerdarm derart, dass er nach über 7 Jahren Haft, im Juli 1963 einriss. Da Lebensgefahr bestand, weil ich schon viel Blut verloren hatte, fuhr man mich sofort im Sanka ins Haftkrankenhaus Klein Meusdorf in Leipzig. Das sind rund 65 Kilometer. Zum Stadtkrankenhaus Torgau um die Ecke, kam für politische Häftlinge nicht in Frage. Das durfte nicht sein. Vorzeitige Haftentlassung wegen lebensgefährlicher Erkrankung gab es in der DDR für politische Häftlinge sowieso nicht. Die Betroffenen starben in Haft. Ich habe drei gekannt. In Meusdorf war damals eines der größten Haftkrankenhäuser der DDR. Dort wurden schwierige Operationen von Ärzten der Universitätsklinik Leipzig durchgeführt. Polizei Ärzte waren noch nicht soweit und machten höchstens Blinddarmoperationen. Ich hatte einen „interessanten Magen“, wie sie sich zwei von ihnen ausdrückten und sie führten beide die Operation am 12. August 1963 durch. Einige Tage davor, die Blutung war nach vielen Spritzen zum Stillstand gekommen, eröffneten sie mir zwei Möglichkeiten. Jetzt so lassen, doch dann könnte es jederzeit wieder einreißen und ohne Hilfe binnen zwei Stunde zum Tode führen. Oder Operation und entfernen von 2 drittel des unteren Magens nebst Magenausgang. Heute gibt es diese Operation nach Billroth II nur noch bei schwerer Krebserkrankung.
Ich hatte von den 10 Jahren noch 2 ½ vor mir und die feste Absicht die auch noch zu überstehen, also stimmte ich für die Operation. Vorausgegangen waren natürlich interne Informationen. Ich lag auf eine 10 Mann Krankenstubenzelle. Schon Operierte und noch zu operierende darunter. Über Besuche und vom Krankenpfleger Häftling sprach sich hinter der Hand viel herum. „Meine“ beiden Ärzte waren Koryphäen auf dem Gebiet. Das half bei meiner Entscheidung.
So eine Operation schwächt natürlich den Körper. Von vorher 71 Kilo blieben noch 56 an Gewicht. Die Nachpflege auf einer Krankenzelle und auf der Genehsungszelle beschleunigt unter diesen Umständen auch nicht die Gesundung. Ich wollte wieder zurück nach Torgau, aber unter 60 Kilo Gewicht wollte man mich nicht für den Transport freigeben. Dass ich mir durch die Bluttransfusionen aus Konserven noch eine Leberentzündung einhandelte, wurde erst 1968 im Versorgungskrankenhaus in Bayreuth festgestellt. Die war dann inzwischen chronisch geworden. Also ein paar ganz schöne Schrammen sind mir geblieben.
Ende September kam ich wieder nach Torgau in meine alte Stellung. Zum Ende des Jahres wurden plötzlich alle zu mehr als 8 Jahren Verurteilte aus Torgau verlegt. Weil meist wir so genannten Langstrafer fast alle Positionen für die Fertigung innehatten, versuchte die Betriebsleitung uns in Torgau zu behalten. Die Anweisung zu dieser Aktion kam jedoch von ganz oben, so dass nur ein Meister, der Arbeitsvorbereiter und ich bis Januar zurückgestellt wurden. Das bis Januar wussten wir natürlich nicht. Alle anderen kamen, wie später die Häftlingsbuschtrommel tönte, nach Brandenburg.
Die internen Infos zwischen den Häftlingen funktionierten, weil die Anstalten immer wieder Häftlinge untereinander austauschten.
Rauchen war die ersten Jahre auf den Zellen verboten. Arbeiter bekamen am Arbeitstag 3 Zigaretten zugeteilt. Sonntags eine, weil nur während der so genannten Freistunde rauchen erlaubt. Zum Rauchen mussten sich die Gefangenen in Doppelreihe gegenüber aufstellen. Der Wärter gab dem Schichtführer die Zigaretten, der teilte sie aus. Nach der Rauchpause wurden die Kippen eingesammelt und dem Wärter in die Hand gezählt. Die Zigaretten musste jeder natürlich von seinem Geld bezahlen. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Anstalt ¾ des Verdienstes einbehielt. Vom restlichen Geld ging etwas als Familienunterstützung zu den Familien die im Osten wohnten. Bei uns deren Familien im Westen waren ging das auf ein Sperrkonto. Genau wie noch ein kleiner Betrag zum Entlassungstag. Für den zusätzlichen Einkauf hatte man, je nach Arbeitsleistung (Normerfüllung), 20,- bis 30,- Mark zur Verfügung. Dazu gab es einen Verkaufsraum in dem wir einmal im Monat Schichtweise einkaufen konnten. Wer wie ich, wegen meines Magens, auf Diät gesetzt war, bekam keine Zigaretten. Um trotzdem an Zigaretten zu kommen sucht man sich einen Nichtraucher, kaufte dem für das Zigarettengeld was er wollte und schon hatte man seine Zigaretten. Natürlich war das verboten.
Rasiert wurde von einem Gefangenen zweimal in der Woche auf dem Flur. Haarschneiden ebenfalls. Auf den Zellen hatten wir so gut wie nichts. Die Alublechschüssel in der es morgens und abends den Kaffe gab, gebrannt aus Getreide und mittags das Essen. Dazu den Alulöffel.
Persönliches gar nicht. Zu Weihnachten und Ostern konnte man auf Antrag über die Feiertage ein Familienbild aus den Effekten bekommen. Voraussetzung gute Führung und gute Arbeitsleistung.
Schreiben durfte man einmal im Monat 20 Zeilen auf DIN A4. Die ersten Jahre hieß es dann heraustreten zum Schreiben. Es ging in eine größere Zelle auf die Station 15, in der Tische und Hocker standen.
Mit dem Fortschreiten der Jahre besserte sich einiges. Man konnte eigenes Rasierzeug kaufen. Bekam mehr Zigaretten, auch wieder je nach Arbeitsleistung. Wir durften auf Zelle schreiben, rauchen und hatten Streichhölzer. Das Essen wurde in Porzelanschüsseln ausgegeben. Die leeren Schüsseln wurden vom Kalfaktor zum Spülen und neu verwenden eingesammelt. Wir kauften uns Bestecke zum Zusammenstecken und man konnte wieder mit Messer und Gabel essen.
Im Frühjahr 1964 brodelte die Gerüchteküche. Nix genaues wusste man jedoch nicht. Anfang August kam ein Wärter zu mir in die Arbeitshalle und sagte: „Geben sie ihr Zeug hier ab, in einer halben Stunde hole ich sie“! Danach musste ich meine Sachen von der Zelle holen und wurde in eine Zelle auf eine freie Station verlegt. Dazu kam dann noch einer aus unserem Kommando. Er war in Hildesheim zuhause. Gesagte wurde weiter nichts, aber das war so üblich bei denen. Ich hatte, weil seit ca. einem Jahr Organisationsleiter der Kulturgruppe (Musikgruppe und Chor), noch einiges dort im so genannten Kultursaal zu erledigen. Wir hatten dort unseren Raum zum Üben. Ich ließ mich dazu immer nach der Arbeit und dem Abendessen aus der Zelle herausschließen. Das funktionierte so. Ich hatte vorher beim Einschließen in die Zelle dem Wärter gesagt, ich müsste nachher in den Kultursaal, oder ich klopfte an die Tür bis der Wärter kam. Das funktionierte jetzt auch noch, trotzdem so eine Verlegung immer gleich eine Kontakteinschränkung mit anderen Gefangenen einschloss. So bekam ich weiter interne Häftlingsinformationen. Das waren natürlich immer nur Vermutungen bei den meist Wünsche eine große Rolle spielten. Informationen von draußen, wenn es uns Häftlinge betraf, auch manches persönliche, waren verboten. Stand in den monatlichen 20 Zeilen Briefes etwas was wir nicht lesen sollten, wurde der Brief vom jeweiligen Wärter vorgelesen und diese Stellen ausgelassen. Anfangs hatte man das herausgeschnitten. Da sah der Brief dann aus wie eine Lebensmittelkarte in der letzten Dekade. Nachdem das draußen bekannt wurde, schwärzte man diese Sätze. Nur gelang es uns mit Möglichkeiten auf Arbeit diese wieder lesbar zu machen. Darauf kam das Vorlesen. Jeder Brief nach draußen wurde genau so kontrolliert. Man schrieb also nicht nur an seine Lieben, sonder gleichzeitig für die Volkspolizei. Fanden sie etwas was denen nicht gefiel, musste man den Brief nochmals schreiben. Ich habe meinen letzten für August 1964 zweimal zurückbekommen. Es ging darin um die Zeit nach meiner offiziellen Entlassung in 15 Monaten. Also etwas, was der Anstalt im Grunde gar nicht mehr anging. Man macht uns das schwere Leben möglichst noch schwerer. Wir sollten ganz klein gemacht werden und vor denen unbedingt zu Kreuze kriechen. Das nannten sie Umerziehung. Die war nach 8 Jahren bei mir immer noch nicht erreicht, wie ein Staatanwalt auf ein Gesuch meiner Angehörigen schrieb. Ich hatte nichts anderes erwartet. Doch sie sollten sich durch diese Gesuche immer wieder mit unseren Akten beschäftigen. Mindest jedes Jahr einmal.
Am 17. August hieß es dann wieder: „Nehmen sie ihre Sachen und kommen sie!“ Es ging zu einem Gefangenentransport Auto. Einem grünen Lastwagen mit geschossenem Aufbau in dem Links und rechts eines Mittelganges kleine verschließbare Zelle eingebaut waren. Wir waren jetzt zu acht. Was uns sofort auffiel, die Zellen blieben offen. Das gab es bisher nie und wurde von uns als gutes Zeichen registriert. Wir waren stundenlang unterwegs. Da diese Fahrzeuge keine Fenster im Aufbau haben, nur Lüftungsschlitze sahen wir nicht wohin die Reise ging. Auf irgendeinen Gefängnishof stiegen wir aus und wurden auf Zellen gebracht. Immer zu zweit. Wir wussten immer noch nicht was das wird. Die Gefangenen Buschtrommel signalisierte (in dem Fall Klopfzeichen an den Wänden) es käme zu Entlassungen. Nach ein paar Tagen wurde ich geholt. Es ging in einen großen Raum, der als Verkaufsraum mit allerhand Zeug eingerichtet war. Man eröffnete mir ich könnte ja meine alten Zivilsachen nicht mehr tragen und ich solle mir hier von meinem Geld auf dem Sperrkonto, es war auf 1.500,- Mark angewachsen, Sachen kaufen. Möglichst für das ganze Geld. Vom Entlassen werden sprach niemand dabei. Man ließ uns bis zur letzten Minute im Ungewissen. Eine Anzughose musste geändert werden, zu lang. Ein Schneider, natürlich Häftling, war gleich zur Stelle und nahm Maß. Ich kaufte ein Haufen Sachen zusammen. War dabei wie in Trance. Das hatte ich so nicht erwartet. Die ganzen Sachen im Koffer und Lederaktentasche untergebracht ging es ab in die Zelle. Das hatte es bisher in den DDR Gefängnissen bei zu Entlassenden noch nie gegeben. Doch wir waren ja wieder bei der Stasi gelandet. Sie hatten uns in der ganzen DDR nacheinander einsammeln lassen und nach Berlin gebracht. Die Sachen mussten im Koffer bleiben bis man zum Anziehen aufgefordert wurde. Mein Zellenkollege aus Hildesheim war erst 2 Jahren in Haft und brauchte keine neuen Sachen. Natürlich wurde die Entwicklung gleich per Klopfzeichen weiter gegeben.
Ein paar Tage später wurden wir beide geholt. In einem Raum händigte man uns so etwas wie Entlassungsschein aus und wir sollten warten. Mit diesem Schein bekam ich meinen letzten großen Schock der Stasi versetzt. Es stand nämlich entlassen zum letzten Wohnsitz in der DDR drauf.
Das war für mich furchtbar. Wie danach zu meiner Familie in den Westen kommen. Es war die größte Befürchtung am Ende meiner Haftzeit.
Ich hatte nicht viel Zeit zum überlegen, musste danach gleich in ein Büro ähnlichen Raum mit einem Stasi Major am Schreibtisch. Der sagte dann, ich werde zu meiner Familie in West-Berlin entlassen.
Den Stein der mir dem Moment vom Herzen fiel hätte er hören müssen!
Jedoch geht es erst in die BRD, aber das wäre wohl nicht so schlimm. Heuchler dachte ich, jetzt tut er so als wolle er in „Freundschaft“ von mir scheiden. Ich wurde dann noch, wie alle andere auch, für die Fahrt in den Bussen durch die DDR, vergattert. Wie wir uns auf der Fahrt zu verhalten hätten und dass wir bei Fahrtpausen auf Parklätzen keinen Kontakt zu zufällig anwesenden Zivilisten aufnehmen dürfen. Am nächsten Tag durften wir unser Zivil anziehen. Es ging nochmals kurz in Gefangenenlastwagen zum Stasigefängnis Hohenschönhausen, jetzt Gedenkstätte. Dort im Hof stiegen wir mit unserem Gepäck in Busse, es waren 3 und ab ging es. In jedem Buss fuhr ein Stasi Mann in Zivil mit. Vorn Weg ein PKW dieser Truppe. Auf der Fahrt kontrollierten der Westanwalt Stange und der Ostanwalt Dr. Vogel mit Listen, ob alle die drauf standen auch in den Bussen waren.
Die Listen waren damals von Westdeutscher Seite erstellt worden. Die Namen von uns waren schon lange bekannt. Mein Name stand z. B. schon 1956 unter politische Gefangene der DDR in der Zeitung Vorwärts in Westberlin. Mein Vater hatte diese Zeitung aufgehoben. Ich habe die Seite heute noch.
Abends in einem abgelegenen Wald Platz bei Herleshausen angekommen, stiegen wir in West Busse und ab ging es in die Freiheit. Das Gefühl nach dem überfahren der Grenze kann man einfach nicht beschreiben. Endlich frei - war einfach schön und herrlich! Es war der 28. August 1964.
Im Flüchtlingslager Gießen, auch Auffanglager für Spät Heimkehrer, blieben wir eine Nacht. Nach Abwicklung der Formalitäten konnte jeder mit dem Zug zu seinen Angehörigen fahren.
Wir erfuhren erst jetzt, dass wir von der Bundesrepublik freigekauft wurden. Diese Verhandlungen dazu liefen schon mindest 2 Jahre. Ich war beim dritten Transport dabei. Die Namen wurden nach dem Alphabet geordnet und abgearbeitet.
Die späteren Freikäufe, die es ja bis zum Ende der DDR gab, verliefen anders. Kaum noch über Berlin.
Horst Kreeter