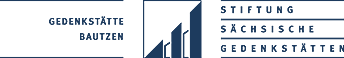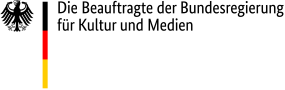„Wer nichts wagt, kommt nicht nach Bautzen“
Die ehemalige Sonderhaftanstalt der Staatssicherheit ist Symbol politischer Verfolgung in der DDR, heute lockt sie als Gedenkstätte jährlich über 100 000 Besucher an
Gießener Anzeiger vom 7. Mai. 2011
Von Benjamin Lemper
BAUTZEN. Schon als Kind ist Stefan Risopp ein Einzelkämpfer. Unangepasst. Aufsässig. Mit „eigenem Kopf“. Das Gruppendasein in der DDR „war daher überhaupt nicht mein Ding“, sagt der 56-Jährige. Das ganze System ist ihm zuwider. Folglich verbüßt Stefan Risopp bereits von 1969 bis 1972 seine erste Haftstrafe – wegen widerständigen Verhaltens. „Staatsverleumdung“ und „Widerstand gegen die Staatsgewalt“ bringen dem gelernten Maschinenschlosser weitere Jahre hinter Gittern ein. Volkspolizei und Staatssicherheit haben ihn fortan im Visier. Für den jungen Mann steht fest, er muss die DDR verlassen. Doch seine Ausreiseanträge werden abgelehnt. Ihm bleibt nur die „Republikflucht“. Zusammen mit seiner inzwischen geschiedenen Frau versucht Risopp 1982, über die damalige Tschechoslowakei in den Westen zu gelangen, wird aber von Grenztruppen erwischt. Drei Jahre und drei Monate muss er deshalb im „Stasi-Knast“ Bautzen II – zwischen 1956 und 1989 das Gefängnis für sogenannte Staatsfeinde – absitzen. Stefan Risopps trauriger Blick verrät, diese Zeit hat tiefe Narben hinterlassen. An manchen Tagen könne er nicht in die Öffentlichkeit, erzählt er. Noch immer fällt es dem kräftig gebauten Mann mit dem kahl rasierten Kopf schwer, über das Erlebte zu sprechen, die richtigen Worte zu finden. Erst recht am Ort der Unterdrückung. Denn die beschauliche mittelalterliche Kleinstadt Bautzen in der südöstlichsten Ecke der einstigen DDR wird im 20. Jahrhundert zum Symbol für politische Verfolgung, Willkürjustiz und unmenschliche Haftbedingungen. Geprägt von zwei Gefängnissen: Bautzen I, aufgrund der Farbe seiner Klinkerfassade im Volksmund „Gelbes Elend“ genannt, und nicht zuletzt als sowjetisches Speziallager (1945-1950) berüchtigt. Und eben Bautzen II.
SCHEIN BLEIBT GEWAHRT. Längst wird die kommunistische Repression auch hier aufgearbeitet. Während sich in Bautzen I seit 1990 wieder eine Justizvollzugsanstalt befindet, ist in Bautzen II seit 1993 eine sehr informative und sehenswerte Gedenkstätte eingerichtet. Dort gilt es, über Ausstellungen, Hörstationen, Zeitzeugenvideos, Filmaufnahmen, originale Exponate, regelmäßige Theater- und Tanzaufführungen, Lesungen, Projekttage für Schüler und natürlich die eigene Anschauung den historischen Ort zu erschließen und an die damit verbundenen Haftschicksale zu erinnern. „Wir brechen mit den üblichen Darstellungsformen von Geschichte. Nur Texttafeln sind uns zu wenig“, erklärt Pressesprecherin Susanne Hattig. Die Besucherzahlen jedenfalls steigen ständig. Im Jahr 2010 waren es 101800. „Wer nichts wagt, kommt nicht nach Bautzen“ lautet damals ein geflügeltes Wort in der Bevölkerung. Es deutet zumindest eine Ahnung an, was demjenigen passieren kann, der mit der Staatsmacht in Konflikt gerät. Denn vornehmlich umranken die mitten in einem Wohngebiet gelegene Haftanstalt zu DDR-Zeiten Gerüchte. Schließlich war „der Strafvollzug in Ostdeutschland […] öffentlicher oder gar kritischer Erörterung weitgehend entzogen“, schreiben Karl Wilhelm Fricke – von 1956 bis 1959 selbst in Bautzen II inhaftiert – und Gedenkstättenleiterin Silke Klewin in der Dokumentation „Bautzen II – Sonderhaftanstalt unter MfS-Kontrolle 1956 bis 1989“. Das trifft besonders auf Bautzen II zu, das einen Sonderstatus genießt. Offiziell dem Ministerium des Inneren unterstellt, hält tatsächlich das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) die Zügel in der Hand; entscheidet, welche Häftlinge dorthin verlegt, wer wie verhört, bespitzelt, isoliert, schikaniert und demoralisiert wird. Die Zuständigkeit der Stasi aber bleibt bis 1989 verborgen, der Schein eines normalen Gefängnisses wird nach außen gewahrt – sofern es als solches zu identifizieren ist, weisen doch selbst die vergitterten Fenster sämtlich zum Innenhof. Von August 1956 bis Dezember 1989 sind in Bautzen II insgesamt 2350 Menschen inhaftiert, darunter 90 Frauen. Durchschnittlich ist das 1906 errichtete Gebäude mit 150 Gefangenen belegt. Zu 80 Prozent haben die Verurteilungen einen politischen Hintergrund, wenngleich offiziell in der DDR freilich keine politischen Gefangenen existieren. Prominente Kritiker der SED-Diktatur gehören ebenso dazu wie ehemalige Funktionäre und Geheimnisträger – etwa der erste DDR-Außenminister Georg Dertinger – oder Ausländer, vor allem aus der Bundesrepublik, die als Ausland betrachtet wird. Wie aus einer Anstaltschronik von 1961hervorgeht, werden den Inhaftierten „größtenteils staatsgefährdende Delikte mit teilweise hohem Grad von Gesellschaftsgefährlichkeit“ vorgeworfen. Laut Fricke und Klewin hat sich an diesem Vollzugsprofil bis zum Ende der DDR nichts geändert. De facto verbergen sich hinter den unter „Staatsverbrechen“ zusammengefassten Straftatbeständen wie „Spionage“, „Terror“, „Hetze“ oder „Grenzverletzungen“ aus Sicht eines demokratischen Rechtsstaates selbstverständliche Grundrechte: Informations-, Meinungs-, Demonstrations- und Reisefreiheit, die auch mancher DDR-Bürger wahrzunehmen versuchte. Stefan Risopp wird in seiner Akte gar als Terrorist geführt. Dabei scheint sich die Stasi bei seiner Vernehmung in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) gar nicht für ihn zu interessieren. Alles dreht sich um seinen Zellengenossen während der U-Haft im tschechoslowakischen Pilsen, der wegen „Schleusung“ festgehalten worden ist. Die Stasi hofft, durch Risopp mehr über die Hintermänner zu erfahren. Sogar die Ausreise stellen sie in Aussicht. „Über die Flucht hätten sie offenbar hinweggesehen“, glaubt der 56-Jährige. Da er nicht kooperiert, bekommt er die Höchststrafe.
DEMÜTIGENDER ALLTAG. Statt Richtung Grenze geht es am 24. Juni 1983 in einem Kleintransporter, getarnt mit der zynischen Aufschrift „Frischer Fisch auf jeden Tisch“, nach Bautzen. Eine gefühlte Ewigkeit harrt er in seinem fensterlosen Verschlag aus, denn die Insassen sollen bewusst orientierungslos gelassen werden. Wirklich orientieren kann sich Stefan Risopp in Bautzen II noch immer nicht. Als er 27 Jahre später bei einem Rundgang mit zitternden Händen das erste Mal die kleine Zelle aufschließt, in der er monatelang eingepfercht mit drei weiteren Häftlingen zubringen musste, schießen ihm sofort Tränen in die Augen. Der demütigende und zermürbende Haftalltag, die totale Überwachung, das Abgeschirmtsein ohne Lebenszeichen von draußen und mit nur begrenzten Kontakten im Innern, das ohnmächtige Gefühl angesichts der inszenierten Stasi-Allmacht – all das scheint dem selbstständigen Transportunternehmer plötzlich wieder sehr präsent. Fast ein bisschen stolz macht es ihn jedoch, dass er sich nicht hat „umkrempeln“, zum „sozialistischen Bürger bekehren“ lassen. Denn Ziel des Strafvollzugs ist nicht nur, die Straftäter sicher zu verwahren, sondern auch, sie zu „erziehen“. Dafür sollen unter anderem die hauptamtlichen Verbindungsoffiziere der Stasi – Spitzname „Onkels“, da ihre eigentlichen Namen unbekannt sind – sorgen, indem sie die „politisch-operative Bearbeitung“ der Gefangenen auch in der Haft fortsetzen. Kernstück der „Erziehung“ in einem streng militärisch reglementierten Tagesablauf ist die „produktive Arbeit“. Die erweist sich allerdings als eintönig und primitiv und bringt nur eine äußerst geringe Vergütung ein. Zudem sind die Arbeitsbedingungen im kalten, verwahrlosten, halbdunklen Keller miserabel. Zu wiederholten Beschwerden veranlassen auch die minderwertige Ernährung, schlechte sanitäre Verhältnisse, unzureichende medizinische Versorgung und die spärliche Zellenausstattung. Das bessert sich erst in den 70ern, bemüht sich die DDR nun zusehends um internationales Ansehen. „Mit der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte in Helsinki [...] 1975, die die Anerkennung internationaler Menschenrechtsstandards einschloss, kam die DDR-Staats- und Parteiführung nicht umhin, auch den Strafvollzug zu lockern“, ist bei Fricke und Klewin nachzulesen. Auch die juristische und humanitäre Betreuung der Häftlinge durch westliche Diplomaten – besonders seit Einrichtung einer Ständigen Vertretung der BRD 1974 in Ost-Berlin – rückt den Strafvollzug stärker ins Licht der Öffentlichkeit. Vor willkürlichen Strafen schützt das die Gefangenen trotzdem nicht. Stellen die Wachleute bei ihren zahlreichen Kontrollen Verstöße fest, etwa verbotene Gespräche oder den heimlichen Austausch von Nachrichten, leiten sie Disziplinarmaßnahmen ein. Provozierendes Verhalten, Gehorsams- oder Arbeitsverweigerung werden ebenfalls geahndet. Zwischen Tadel, eingeschränkten Vergünstigungen und drei Wochen verschärftem Arrest ist alles möglich. Was dort geschieht, schildert Werner König (1981 bis 1983 in Bautzen II) besonders eindrücklich: „Mir hat keiner mit dem Gummiknüppel einen auf den Latz gehauen […]. Die haben mich in dem ‚Tigerkäfig‘ mit einem Fuß und einer Hand angekettet. Und wenn ich zur Toilette wollte, dann habe ich mich einkoten und einnässen müssen. […] Es gibt Experten, die sagen, das hat doch mit Folter nichts zu tun. Ich meine, das ist die subtilste Form, einen Menschen in seiner Substanz zu zerstören.“
„VERBOTENE ZONE". Dass er verhaltensmäßig nicht „der Feinste“ gewesen sei, räumt auch Risopp ein. Nach wie vor erbost er sich, wenn er an die permanente Propaganda aus den Lautsprechern denkt: „Da verbringst du deine Zeit in Haft und die reden davon, wie human der Staat ist.“ Statt den Lautsprecher einfach leiser zu drehen, reißt er ihn mit dem Hocker ab. Es ist ein Akt der Selbstbehauptung, um der Entmündigung zu entgehen. Für den jungen Mann endet er in
Isolationshaft. Neben den bereits bestehenden Isolationsbereichen wird im März 1979 speziell für den prominenten Gefangenen Rudolf Bahro in einem abgetrennten Flur ein Isolationstrakt eingerichtet – die „Verbotene Zone“. Bahro hatte heimlich Briefe in den Westen übermittelt. Im Oktober 1979 beugt sich die DDR internationalen Solidaritätsbekundungen und lässt ihn vorzeitig frei. Über neun Jahre muss dagegen Bodo Strehlow in Isolationshaft verbringen, bekommt in dieser Zeit nur 17 Menschen zu Gesicht, ehe er im Zuge der „Friedlichen Revolution“ 1989 begnadigt wird. Die Ausstattung seiner Zelle hat er später mit originalem Mobiliar rekonstruiert. Insgesamt gibt es mehrere solcher Orte, die in der Gedenkstätte das Funktionieren des Gefängnisbetriebes veranschaulichen: vom Garagenhof über die (Abhör-)Zellen, die Arbeits- und Freizeitbereiche, die Diensträume der Stasi und der Gefängnisleitung bis zu den Freiganghöfen. Nicht alles ist wieder komplett hergerichtet. Beispielhaft werden darüber hinaus 20 Häftlingsbiographien vorgestellt, wie die von Bahro und Strehlow. Auch die Geschichte von Dieter Hötger ist erzählt. Ihm gelingt 1967 als Einzigem der (vorübergehende) Ausbruch. Was folgt, ist eine der größten Fahndungsaktionen der DDR. Danach hat es nachweislich keine weiteren Versuche gegeben. So bleibt für die Gefangenen meist nur der Freikauf durch die Bundesrepublik oder durchzuhalten bis zum letzten Tag. Der ist für Stefan Risopp Ende April 1986 gekommen. Noch während der Haft gibt er dem Anstaltsleiter mit auf den Weg: „Ewig geht das nicht mit Euch.“ Dass es tatsächlich so schnell geht, hat er vermutlich nicht gedacht. Eine große Genugtuung ist der Zusammenbruch der DDR für ihn aber doch.