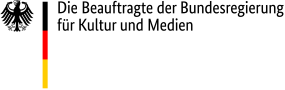Rede von Dr. Bert Pampel auf der Gedenkfeier anlässlich des 66. Jahrestages der Befreiung des Kriegsgefangenenlagers Zeithain am 23. April 2011
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
in Vertretung des Geschäftsführers der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, Siegfried Reiprich, begrüße ich Sie zu dieser Gedenkfeier. Wir erinnern heute gemeinsam an die Befreiung des Lagers Zeithain vor 66 Jahren am 23. April 1945 durch die Rote Armee. Wir gedenken der über 30.000 hier verstorbenen sowjetischen Kriegsgefangenen. Wir gedenken aber auch der italienischen Militärinternierten und der polnischen und serbischen Gefangenen. Es waren Großväter, Väter, Söhne, Enkel, Brüder und Onkel; wir gedenken deshalb auch des Leids der Familienangehörigen, Hinterbliebenen und Freunde.
Dass wir heute hier zusammenkommen, um diesen Opfern die Ehre zu erweisen, ist nicht selbstverständlich. In den 50-er, 60-er und 70-er Jahren des 20. Jahrhunderts interessierten sich in Deutschland nur sehr wenige ernsthaft für das Schicksal der „Russen“. In der DDR waren sie durch Schullektüre, Filme und menschliche Begegnungen zwar präsenter. Doch die „Deutsch-Sowjetische Freundschaft“ war nur wenigen Herzensangelegenheit. In der Sowjetunion wurden die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, die die unmenschlichen Bedingungen überlebt hatten, diskriminiert. Sie wurden verdächtigt, „Vaterlandsverrat“ begangen zu haben.
Heute sind die sowjetischen Kriegsgefangenen meines Erachtens keine vergessene Opfergruppe mehr. Im kollektiven Gedenken und der öffentlichen Erinnerung spiegelt sich ihr historischer Stellenwert als zweitgrößte Opfergruppe des Nationalsozialismus jedoch noch nicht angemessen wider. Auch die Zukunft der Erinnerung ist unsicher. Das Thema löst immer noch Unbehagen und Abwehr bei uns Deutschen aus.
Die Jahre vergehen, neue Generationen betreten die Bühne des Lebens. Meine 18-jährige Tochter hatte jüngst eine schwedische Austauschschülerin zu Gast. Auf ihrem Besuchsprogramm stand auch ein Besuch der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen bei Berlin. Auch mehrere Tausend sowjetische Kriegsgefangene wurden während des Zweiten Weltkrieges dort in einer Massenerschießungsanlage ermordet. Meine Tochter fragte mich: Müssen wir denn die Schweden unbedingt auf dieses Thema anstupsen? Und dahinter standen Fragen, wie: Was hat das alles noch mit mir zu tun? Warum werden wir als junge Deutsche immer noch damit konfrontiert?
Die nationalsozialistischen Verbrechen sind heute Schulstoff, die Beschäftigung damit Unterrichtsroutine. Der zeitliche Abstand macht es jedoch immer schwieriger, einen persönlichen Bezug zu entwickeln. Ihren Urgroßvater väterlicherseits, der als Soldat der Wehrmacht vor Smolensk stand, hat meine Tochter im Gegensatz zu mir nicht mehr kennengelernt. An einen anderen Urgroßvater, der am Überfall auf Frankreich beteiligt war, hat sie nur blasse Kindheitserinnerungen.
Aber der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche hat hellsichtig formuliert: „Die Folgen unserer Handlungen fassen uns beim Schopfe, egal ob wir uns inzwischen gebessert haben.“
Dies wird der deutschen Öffentlichkeit mit einem neuen Buch gerade erneut vor Augen geführt. In ihm geht es um abgehörte Gespräche gefangener deutscher Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften, die in amerikanischen und britischen Archiven gefunden worden sind. Auf Tausenden Seiten Papier ist festgehalten, was diese sich untereinander über den Krieg erzählten. Sie wussten nicht, dass sie abgehört wurden. Es sind Schilderungen von der Lust am Töten, von zivilen Opfern, die nicht als Menschen, sondern nur als Zielobjekte wahrgenommen werden. Es sind Erzählungen ohne Worte des Bedauerns oder Mitgefühls, Erzählungen auch von sexuellen Gewalttaten, deren Schilderung kaum erträglich ist. Beispielhaft möchte ich heute den von einem Generalmajor Walter Bruns geschilderten Ablauf einer typischen „Judenaktion“ vortragen:
„Die Gruben waren 24 Meter lang und ungefähr 3 Meter breit. Mussten sich hinlegen wie die Sardinen in eine Büchse, Köpfe nach der Mitte. Oben sechs Maschinenpistolenschützen, die dann den Genickschuss beibrachten. Wie ich kam, war sie schon voll, da mussten die Lebenden also dann sich drauflegen, und dann kriegten sie den Schuss; damit nicht so viel Platz verlorenging, mussten sie sich schön schichten. Vorher wurden sie aber ausgeplündert (…) Es war eine anderthalb Kilometer lange Schlange, und die rückte schrittchenweise. Es war ein Anstehen auf den Tod. Wenn sie hier nun näher kamen, dann sahen sie, was drin vor sich ging. Ungefähr hier unten mussten sie ihre Schmucksachen und ihre Koffer abgeben. Ein Stückchen weiter mussten sie sich ausziehen, durften nur Hemd und Schlüpfer anbehalten. Das waren alles nur Frauen und kleine Kinder, so Zweijährige.“
Angemessene Worte für eine Beschreibung der Gefühle und des Grauens, die solche Zeilen auslösen, fehlen. Aber man kann, man muss fragen: Tun wir als Deutsche wirklich genug, um dies nicht zu vergessen? Meiner Tochter habe ich gesagt: Wir werden nicht nur „damit leben müssen“, dass wir immer wieder daran erinnert und damit in Verbindung gebracht werden. Wir dürfen nicht einmal darauf hoffen, dass die Welt diese Verbrechen vergisst und verzeiht.
Es bleibt unsere moralische Verpflichtung, das Bewusstsein dafür stärker in der Öffentlichkeit zu verankern. Ganz konkret heißt das vor Ort: Das Projekt für die Aufstellung von Namenstafeln für die in Zeithain umgekommenen Gefangenen braucht seitens des Freistaates Sachsen und des Bundes stärkere Unterstützung. Ich danke dem Förderverein der Gedenkstätte dafür, dass er in seinen ständigen und nachdrücklichen Bemühungen hierzu nicht nachlässt.
Mehr Engagement sind wir den Opfern, aber auch uns selbst schuldig. Denn, wie der Auschwitz-Überlebende Primo Levi einmal sagte: „Was einmal geschah, kann wieder geschehen.“
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.