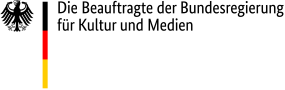Störung der Tümpelfauna. Die Gedenkstätte Zeithain und der Naturschutz
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20.10.2010
Arnold Bartetzky
Am 26. August 1941 besucht Joseph Goebbels zu Propagandazwecken ein Lager für sowjetische Kriegsgefangene bei Zeithain nahe Leipzig. Ziel ist, so ein interner Bericht des Reichspropagandaministeriums, „die Untermenschen in Natur vorzuführen und hierdurch zu zeigen, vor welcher Gefahr uns der Führer und die Wehrmacht gerettet haben“. Der Besuch wurde gefilmt. Nahaufnahmen zeigen ausgewählte Gefangene, deren Aussehen dem Schreckbild des asiatischen Barbaren am ehesten nahekommt. Erstaunlicher als diese plumpe Suggestivität sind Szenen, in denen man Goebbels mit Gefangenen plaudern sieht – ungezwungen, wie Politiker sich bei medial inszenierten Betriebsbesuchen geben.
Sein Tagebuch sagt anderes: „Das Gefangenenlager bietet ein grauenhaftes Bild. Die Bolschewisten müssen zum Teil auf der nackten Erde schlafen“, heißt es da. Gleichzeitig staunt er über die Insassen, die dem von ihm selbst verbreiteten Feindbild nicht entsprechen: „Die Typen sind zum Teil nicht so schlecht, wie ich mir das vorgestellt hatte, nicht so stumpf und vertiert, wie man das aus den Aufnahmen in der Wochenschau annehmen musste.“ Auch der Ministeriumsbericht hält fest, der Besuch habe „insofern nicht das gewünschte Ergebnis“ gebracht, „als die Gefangenen fast durchweg Weißrussen waren und daher durchschnittlich ein durchaus menschliches Aussehen hatten“. Es folgt das Monitum, künftig sicherzustellen, dass „der in den Wochenschauen gezeigte Auswurf gezeigt wird“.
Vom Schauplatz sind nur Spuren erhalten: Nach 1945 nutzte die Rote Armee das planierte Lager als Truppenübungsplatz, den seit ihrem Abzug die Natur zurückeroberte. Doch unter dem Gestrüpp birgt die Erde noch Fundamente und das Schotterbett der Lagerstraße. Seit einigen Jahren organisiert die Gedenkstätte „Ehrenhain Zeithain“ Jugendworkcamps, bei denen diese Reste freigelegt werden – bisher Fragmente der Unterkunfts-, Entlausungs- und Arrestbaracken. Um die Lagergeschichte über die gegenwärtige kleine Ausstellung hinaus auch mittels solcher authentischer Spuren zu vermitteln, plant man einen Geschichtspfad. Jens Nagel, der Leiter der Gedenkstätte, möchte damit mehr Aufmerksamkeit auf eine bis heute marginalisierte Opfergruppe lenken: Mehr als die Hälfte der fünf Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen starb in der Gefangenschaft – Folge der amtlich dekretierten Behandlung als „Untermenschen“. Völkerrechtliche Schutzbestimmungen, die bei gefangenen Soldaten anderer Nationen zumindest teilweise eingehalten wurden, galten in den sechzig „Russenlagern“ nicht. Nach systematischer Unterernährung, katastrophalen hygienischen Verhältnissen und brutaler Gewalt durch die Wachmannschaften erwartete die Überlebenden in der Heimat Verbannung oder erneute Lagerhaft, denn in Stalins Reich galt ein Soldat, der sich gefangen nehmen ließ, statt den Heldentod zu sterben, als Verräter.
In Zeithain starben dreißigtausend sowjetische Soldaten, mehr als in jedem anderen Lager auf deutschem Boden. Grund genug, es als nahezu einzigen diesbezüglichen deutschen Erinnerungsort zugänglich zu machen. Das Konzept der Berliner Bauhistoriker Schulz + Drieschner sieht einen Parcours mit „archäologischen Fenstern“ vor, der das Leben und Sterben im Lager evoziert, aber durch Begrenzungen und zurückhaltende Gestaltung die Pflanzen- und Tierwelt respektiert, die sich hier ausgebreitet hat. Dennoch droht das Projekt an Naturschutzregeln zu scheitern. Denn das Lager ist Teil eines Schutzgebietes, in dem die Anlage von Wegen und das Aufstellen von Informationstafeln untersagt ist. Naturschützer wollen das Gebiet menschenfrei halten, damit sich die „baumarme Sandheide“ mit ihrem Insektenreichtum und „wertvoller Tümpelfauna“ ungestört entfalten kann.
Die Störungen wären minimal, denn der Geschichtspfad würde nur einen Bruchteil des Schutzgebietes einnehmen und sicher keine Menschenmassen locken. Trotzdem sträubt sich die Naturschutzbehörde. Deshalb hofft die Gedenkstätte für die bevorstehenden Verhandlungen auf die Ausgliederung des betroffenen Areals aus dem Schutzgebiet – sie will einen stillen Erinnerungsort schaffen, der Interessierte anzieht, aber die Tümpelfauna nicht stört.